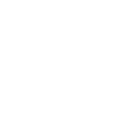Inhalt:
Allensteiner Offizierstragödie
Ein aufsehenerregender Kriminalfall in Allenstein
Antonie von Schoenbeck soll 1907 den jungen Hauptmann Hugo von Groeben zum Mord an ihrem Gatten angestiftet haben.
von Wolfgang Kaufmann
 Im Dezember 1906 wurde der 37-jährige Hauptmann Hugo von Goeben in die ostpreußische Garnisonsstadt Allenstein versetzt, wo er nachfolgend als Chef der 3. Batterie des Masurischen Feldartillerie-Regiments Nr. 37 fungierte. Zuvor hatte der Sohn eines Gutsbesitzers militärische Erfahrungen in Südafrika und auf dem Balkan gesammelt: Erst im Freikorps Deutsches Kommando Johannesburg auf der Seite der Buren, die gegen die Briten kämpften, und dann als Berater der Osmanen bei der Niederschlagung eines Aufstandes in Thrakien und Makedonien. Gleichzeitig war von Goeben in Belangen, die nicht das Kriegshandwerk betrafen, immer noch ausgesprochen naiv. Das zeigte sich, als er 1907 auf einem Kostümball die attraktive Frau des Majors August von Schoenebeck kennenlernte. Der Stabsoffizier beim Ostpreußischen Dragoner-Regiment Nr. 10 in Allenstein und passionierte Jäger vernachlässigte seine Gattin Antonie, die sich dafür mit zahllosen Affären revanchierte – darunter auch mit von Goeben. Diesem log die 31-Jährige vor, ihr Mann behandele sie roh und unehrenhaft.
Im Dezember 1906 wurde der 37-jährige Hauptmann Hugo von Goeben in die ostpreußische Garnisonsstadt Allenstein versetzt, wo er nachfolgend als Chef der 3. Batterie des Masurischen Feldartillerie-Regiments Nr. 37 fungierte. Zuvor hatte der Sohn eines Gutsbesitzers militärische Erfahrungen in Südafrika und auf dem Balkan gesammelt: Erst im Freikorps Deutsches Kommando Johannesburg auf der Seite der Buren, die gegen die Briten kämpften, und dann als Berater der Osmanen bei der Niederschlagung eines Aufstandes in Thrakien und Makedonien. Gleichzeitig war von Goeben in Belangen, die nicht das Kriegshandwerk betrafen, immer noch ausgesprochen naiv. Das zeigte sich, als er 1907 auf einem Kostümball die attraktive Frau des Majors August von Schoenebeck kennenlernte. Der Stabsoffizier beim Ostpreußischen Dragoner-Regiment Nr. 10 in Allenstein und passionierte Jäger vernachlässigte seine Gattin Antonie, die sich dafür mit zahllosen Affären revanchierte – darunter auch mit von Goeben. Diesem log die 31-Jährige vor, ihr Mann behandele sie roh und unehrenhaft. Kopfschuss aus einer Duellpistole
Der leichtgläubige Artilleriehauptmann fasste daraufhin den Entschluss, seine Geliebte aus ihrer angeblich so unerträglichen Lage zu befreien. Zu diesem Zweck drang er am späten Abend des 26. Dezember 1907 in das Quartier von Schoenebecks im Allensteiner Offizierscasino ein und tötete den Major mit einem Kopfschuss aus einer Duellpistole. Zunächst wurde angenommen, von Schoenebeck habe Suizid begangen, weil man seine Dienstwaffe neben ihm fand. Dann jedoch stellte sich heraus, dass hier ein Mordfall vorlag, woraufhin der Verdacht sofort auf von Goeben fiel. Der gab die Tat auch am 31. Dezember zu, nachdem die Ermittler in seiner Wohnung die Duellpistole und etliche belastende Briefe von Antonie von Schoenebeck gefunden hatten. Da der Hauptmann einen mental hochlabilen Eindruck machte, wurde er in zwei medizinischen Einrichtungen psychiatrisch untersucht, darunter auch von dem Pionier der Psychotherapie und Sexualmedizin Albert Freiherr von Schrenck-Notzing. Denn ganz offensichtlich stand von Goeben im Bann seiner manipulativen Geliebten. Daraus resultierte die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit des Offiziers – zumal er bald nach dem Geständnis versuchte, sich das Leben zu nehmen. Verbissen bestritt von Goeben jegliche Anstiftung oder Mitwisserschaft seitens der Frau seines Opfers, die aber ebenfalls verhaftet wurde.
Neuverheiratung noch während des Prozesses
Schließlich sollte Mitte März 1908 der Prozess gegen den Mordschützen vor einem Militärgericht in Allenstein beginnen. Doch zwei Wochen zuvor schnitt sich von Goeben mit dem vermeintlich stumpfen Messer, das er beim Abendessen erhalten hatte, die Kehle durch. Danach stand nur noch Antonie von Schoenebeck im Fokus der preußischen Justiz. Auch sie wurde wie ihr Liebhaber zunächst mehrere Wochen lang in der Provinzial-Heil- und Pflege-Anstalt Kortau, einer psychiatrischen Einrichtung unweit von Allenstein, untergebracht und beobachtet, bevor sie gegen Kaution freikam. Diese betrug 50.000 Mark – nach heutigen Geldwert immerhin rund 340.000 Euro. Wer die Summe hinterlegte, ist unklar. Am Ende musste sich Antonie von Schoenebeck aber ab dem 6. Juni 1910 wegen Beihilfe und Anstiftung zum Mord vor Gericht verantworten, wo sie unter anderem von den beiden Berliner Strafverteidigern Erich Sello und Walter Behn vertreten wurde. Noch während ihres Prozesses ehelichte die Majorswitwe den Schriftsteller Alexander Otto Weber. Dem folgte am 22. Verhandlungstag die Einstellung des Verfahrens wegen Verhandlungsunfähigkeit der Angeklagten, wobei fraglich ist, ob diese echt war oder nur vorgetäuscht wurde. Jedenfalls unterblieb die für später geplante Wiederaufnahme des Prozesses, weil die Verdächtige unter die Vormundschaft eines ihrer Rechtsanwälte kam, was jede weitere Strafverfolgung ausschloss. Die Ehe zwischen von Schoenebeck und Weber hielt nicht allzulange, woraufhin sich die Entmündigte in die Arme von Webers Bruder flüchtete, der sie schließlich ebenfalls heiratete. Der wohlhabende Bankier Fritz Weber konnte seiner Frau ein luxuriöses Leben bieten, das bis 1931 währte. Dann starb die treibende Kraft hinter von Goebens Tat im mondänen Riviera-Badeort Rapallo. Zu diesem Zeitpunkt war die „Allensteiner Offizierstragödie“, wie der Mordfall aus dem Jahre 1907 meist genannt wurde, weitgehend vergessen, obwohl sie früher viel Staub aufgewirbelt hatte. Letzteres lag vor allem daran, dass der umstrittene Journalist Maximilian Harden im Sommer 1910 drei Artikel über Hugo von Goeben veröffentlichte, die seine Tat aus sexualpathologischer Sicht zu erklären versuchten, was als „unzüchtig“ galt. Darüber hinaus berichtete auch die Presse in den USA und Frankreich über den Mord und den Prozess. Dieser geriet zeitweise sogar zum Thema im Preußischen Abgeordnetenhaus, wo man über die Notwendigkeit von neuen gesetzlichen Regelungen für eine Strafminderung bei Unzurechnungsfähigkeit diskutierte.
Quelle: PAZ Nr.6 - 9. Februar 2024
Blick über Ostpreußens Himmel hinaus
Vor 550 Jahren wurde der Astronom Nikolaus Kopernikus geboren – Veranstaltungen im „Kopernikusjahr“
Veit-Mario Thiede
Nikolaus Kopernikus wurde am 19. Februar 1473 in Thorn (Toruń) geboren. Er revolutionierte mit seinem heliozentrischen System das Weltbild der Menschheit. Bis dahin glaubte diese an das geozentrische System. Das erklärt die Erde zum unbeweglichen Mittelpunkt des Weltalls, um den sich die Sonne und alle anderen Himmelskörper bewegen. Kopernikus aber verkündete, dass sich die Erde um sich selbst dreht und dabei wie die anderen Planeten um die Sonne kreist. Anlässlich des 550. Geburtsjubiläums hat Polen das Kopernikusjahr ausgerufen. Es wird mit einem Wissenschaftichen Kongress, Festen, Vorträgen und Sonderausstellungen begangen. Wir begeben uns auf die Spuren des Kopernikus vom Taufbecken im Thorner Dom bis zum Grab im Dom von
Frauenburg [Frombork].
Sein wahrscheinliches Geburtshaus steht in der heutigen Kopernikusstraße. Das aus Backstein erbaute gotische Stufengiebelhaus und das Nachbarhaus beherbergen das von Michał Kłosiński geleitete Nikolaus-Kopernikus-Museum. Dessen interaktive Dauerschau vermittelt historisches und heutiges astronomisches Wissen, stellt Thorn im Mittelalter vor und macht uns mit Leben und Werk von Kopernikus bekannt. Sein gleichnamiger Vater war Kaufmann. Er heiratete die wohlhabende Barbara Watzenrode.
Nach dem frühen Tod der Eltern übernahm der Onkel Lukas Watzenrode die Vormundschaft für Nikolaus und seine drei Geschwister. Der 1489 zum Bischof und Regenten des unter dem Schutz des polnischen Königs stehenden Ermlandes gewählte Watzenrode finanzierte die Ausbildung seines Neffen an der Universität Krakau sowie an italienischen Universitäten. Obendrein verschaffte er ihm die einträgliche Mitgliedschaft im ermländischen Domkapitel zu Frauenburg.
In Thorn macht Kłosiński auf Sonderausstellungen im Altstädtischen Rathaus aufmerksam. Im September startet die Schau „Das Geheimnis der Sonne. Kopernikus, Sohn der Renaissance“. Thema sind seine Studienjahre in Italien sowie der Einfluss der dortigen Renaissancekultur auf sein späteres Werk. Kopernikus studierte ab 1496 an der Universität Bologna Kirchenrecht, an der Universität Padua Medizin und erlangte 1503 an der Universität Ferrara den Titel eines Doktors des kanonischen Rechts. Kłosiński verheißt exzellente internationale Leihgaben, darunter Gemälde von Lorenzo Lotto, Paris Bordone und Jacopo da Palma.
Ausstellungen in Thorn
Am 18. Februar wird die Sonderschau „Das lesenswerteste aller Bücher“ eröffnet. Im Mittelpunkt steht das Hauptwerk von Kopernikus: „De revolutionibus orbium coelesticum“ (Über die Kreisbewegungen der Himmelsbahnen). Kopernikus schrieb über „diese meine Nachtarbeit“: „Was gibt es Schöneres als den Himmel (...) von Philosophen aufgrund seiner außerordentlichen Herrlichkeit sichtbare Gottheit genannt.“ Am Manuskript arbeitete er über Jahrzehnte, wollte es aber aus Angst vor Spott nicht veröffentlichen.
Obwohl Luther und Melanchthon über das kopernikanische System lästerten, weil es nicht in Einklang mit der Heiligen Schrift stehe, begab sich ihr Wittenberger Professorenkollege Rheticus 1539 nach Frauenburg und überzeugte Kopernikus von der Notwendigkeit der Veröffentlichung. Rheticus brachte eine Abschrift des Manuskripts dem Nürnberger Buchdrucker Johannes Petreius. Die Überwachung des Drucks vertraute Rheticus dem Nürnberger Reformator Andreas Osiander an. Der jedoch verfasste anonym ein Vorwort mit Ausführungen, wonach das heliozentrische System bloße Hypothese sei. Johannes Kepler war einer der ersten Wissenschaftler, die das heliozentrische System als physikalische Realität anerkannten. Er korrigierte jedoch die kreisrunden kopernikanischen Planetenbahnen zu elliptischen.
Obwohl Papst Paul III. die ihm von Kopernikus angetragene Widmung seines Hauptwerks angenommen hatte, setzte die Indexkongregation 1616 „De revolutionibus“ als nicht bibelkonform auf die Liste der verbotenen Bücher. Die Sonderschau präsentiert mehrere Exemplare der Erstausgabe von 1543, die interessante Randnotizen aufweisen. Kłosiński kündigt als besondere Attraktion Leihgaben aus der Universitätsbibliothek Uppsala an. Diese Bücher gehörten einst Kopernikus. Als Beute der Schweden im Krieg gegen Polen überstellte sie König Gustav Adolf II. 1626 der Universität.
Auch weit jüngere Bände werden ausgestellt: Kaiser Wilhelm I. ermutigte den „Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst zu Thorn“, die erste gedruckte deutsche Übersetzung von „De revolutionibus“ aus dem Lateinischen anfertigen zu lassen. Sie erschien 1879.
Der Coppernicus-Verein ging aus dem Komitee hervor, welches für das vor dem Altstädtischen Rathaus stehende Kopernikus-Denkmal sorgte. Der Entwurf der 1853 enthüllten überlebensgroßen Bronzefigur war das letzte Werk von Christian Friedrich Tieck, jüngerer Bruder des romantischen Schriftstellers Ludwig Tieck. Ein zur Lebenszeit von Kopernikus entstandenes Porträt ist nicht überliefert.
Gleichwohl hängt im großen Saal des Altstädtischen Rathauses sein berühmtestes „Porträt“. Das um 1580 gemalte Bildnis zeigt Kopernikus im roten Pullunder. Den Kopf leicht zur rechten Körperseite gedreht, scheint er uns aus den Augenwinkeln zu beobachten. Er hat ein mächtiges Kinn. Sein dunkles, lockiges Haar steht an den Seiten weit ab. Diesen Erscheinungstypus weisen die meisten seiner „Porträts“ auf. So auch das in der Nähe des Taufbeckens im Thorner Dom angebrachte Epitaph (vor 1589).
Das wohl eigenwilligste Kopernikus-Porträt versetzten die nach der Flucht und Vertreibung der deutschen Bevölkerung nach Allenstein gekommenen neuen polnischen Einwohner hinter das prächtige Backsteinschloss. Kaiser Wilhelm II. hatte für diese von Johannes Gottfried Götz geschaffene Büste 10.000 Mark bezahlt. Sie stellt Kopernikus mit weit aufgerissenen Augen dar. Bis 1945 stand die 1916 enthüllte Büste vor dem Allensteiner Schloss. Dort sitzt seit 2003 der von Urszula Szmyt geschaffene Kopernikus auf einer Bank und schaut hinüber zum Schloss. Es war in den Jahren 1516 bis 1519 Amtssitz des die Güter des ermländischen Domkapitels verwaltenden Kopernikus.
In Allenstein und Frauenburg
Er kehrte 1520 nach Frauenburg zurück, das jedoch infolge des zwischen Polen und dem Deutschen Orden ausgetragenen „Reiterkriegs“ auf Befehl des Hochmeisters Albrecht von Brandenburg-Ansbach und späteren Begründers des Herzogtums Preußen zerstört wurde. Kopernikus zog sich bis 1521 nach Allenstein zurück und sorgte für die Verteidigung der Stadt gegen den Deutschen Orden.
Im Schloss ist heute das Museum für Ermland und Masuren untergebracht. Über dem Eingang zur ehemaligen Amtswohnung von Kopernikus sind Relikte seiner astronomischen Versuchstafel erhalten. Am 21. März wird in den ehemaligen Wohnräumen zu seinen Ehren eine Sonderausstellung eröffnet. Museumsdirektor Piotr Zuchowski erklärt das Nachdenken über die Zeit zu deren Leitmotiv. Gezeigt werden Uhren und Kalender.
Besondere Attraktion ist das einzige in Polen erhaltene Buch aus dem Besitz von Kopernikus. Er hat auf einige Seitenränder medizinische Rezepte notiert. Kopernikus war Arzt der ermländischen Bischöfe und erteilte auch Herzog Albrecht medizinischen Rat. Weitere seiner handschriftlichen Notizen, Briefe und Dokumente präsentiert die bereits laufende Sonderschau „Kopernikana“ des Museums der Ermländischen Diözese.
In Frauenburg, wo Kopernikus als Domherr wirkte, ragt am Fuß der Anhöhe am Frischen Haff, auf der die mit Wehrmauer, Türmen und Toren ausgestattete Backsteinfestung steht, Mieczyslaw Welters Bronzefigur von Kopernikus auf. Das 1973 enthüllte Denkmal ist der Sieger eines Bildhauerwettbewerbs, wie Dorota Wójcik erzählt. Die Kuratorin des im ehemaligen Bischofspalast eingerichteten Kopernikus-Museums kündigt an, dass ab Juli die anderen Kopernikus-Modelle des damaligen Wettbewerbs zu sehen sind.
Der Gang durch die Kopernikus gewidmete Dauerschau ist empfehlenswert. Zum Auftakt zeigt sie Kopien der berühmtesten Kopernikus-Gemälde. Danach stellt sie Kopernikus als vielseitigen und kenntnisreichen Domherrn vor. Er tritt als Astronom, Verwalter, Arzt und Reformer des preußischen Münzwesens auf, der zuerst erkannte, dass mit der Erhöhung der Geldmenge die Inflation steigt.
Kopernikus bekam 1542 einen Schlaganfall und verbrachte seine letzten Monate mit gelähmter rechter Körperseite, litt unter Gedächtnisverlust und war nicht mehr ansprechbar. Laut Bischof Tiedemann Giese starb Kopernikus, kurz nachdem ein Druckexemplar seines „De revolutionibus“ bei ihm eingetroffen war, am 24. Mai 1543. Das Datum wird heute bezweifelt, da sein Amtsnachfolger bereits am 21. Mai in Frauenburg ankam. Das Manuskript seines Hauptwerkes, das an vielen Stellen von der Druckfassung abweicht, vermachte er Giese. Es befindet sich heute in Krakau.
Kopernikus wurde anonym im prachtvoll ausgestatteten Dom beigesetzt. Seine vermutlichen sterbliche Überreste entdeckten Archäologen 2005. Nach eingehender Untersuchung und kriminaltechnischer Gesichtsrekonstruktion fand ihre feierliche Beisetzung 2010 statt. Einen Grabstein hat er nun auch. Als sein Todestag ist der 21. Mai 1543 angegeben.
Ausstellungen:
Reisetipps:
Lesetipp:
Sigfrid Krebse, „Kopernikus“, Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg 2021, 212 Seiten, 19,95 Euro
Allenstein: In den Tiefen des Burgturms
Wissenschaftler der Polnischen Akademie der Wissenschaften untersuchen verbaute Mühlsteine
Uwe Hahnkamp
Wertvollen Steinen auf der Spur war im September letzten Jahres in Allenstein das Institut für Geographie und Raumplanung der Polnischen Akademie der Wissenschaften mit der zweiten Auflage seines Projekts millPOLstone. Die interdisziplinäre Werkstatt zu „Mühlsteinen in Kirchen in Ermland und Masuren“ führte die Teilnehmer auch in die Tiefen des Allensteiner Burgturms.
Mühlsteine waren in früheren Jahrhunderten sehr wertvoll, dennoch wurden sie oder ihre Reste in den Tiefländern des südlichen Ostseeraums – so die territoriale Eingrenzung der Werkstatt – in Kirchenmauern, aber auch in die Grundmauer der Allensteiner Burg unterhalb des Turms eingemauert. Die Referate am ersten Tag der Werkstatt warfen Fragen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Gebieten auf. Symbolik, Herkunft, Material, aber auch der Erhalt der Mühlsteine als kulturelles Erbe wurden beleuchtet.
Exkursion zu Kirchen ...
Es war nur eine Auswahl der interessantesten Gebäude, die auf der Exkursion am zweiten Tag der Werkstatt besichtigt werden konnten. Vorrangig waren das Kirchengebäude, in deren Mauern Mühlsteine zu finden sind. Bei manchen Bauwerken wurden sie waagrecht, bei anderen senkrecht eingemauert, manchmal waren es nur Bruchstücke, aber immer waren sie bereits sehr abgenutzt oder zerbrochen. „Die Bedeutung der Steine zeigt sich darin, dass sie trotz ihrer Schwere transportiert und genutzt wurden. Ein Mühlstein war aber auch so wertvoll, dass er nur für eine Mauer eingesetzt wurde, wenn er völlig unbrauchbar zum Mahlen geworden war“, erklärte Dariusz Brykała, der Organisator der Veranstaltung, den Zustand der Steine. Das gilt auch für den Mühlstein in der Grundmauer der Allensteiner Burg, der deutlich fühlbare Abnutzungsspuren aus der Zeit aufwies, bevor er ganz zerbrach. Wobei laut dem Architekten und Kenner der Allensteiner Burg ,Jacek Strużyński, die Frage noch offen ist, ob es nur Reste eines Steins sind, der halbiert wurde, oder doch zwei verschiedene Steine.
… und ins Lochgefängnis
Um das Objekt an Ort und Stelle zu besichtigen, stiegen die Teilnehmer der Werkstatt im Interesse ihrer jeweiligen Wissenschaft in kleinen Gruppen in die Tiefen des Lochgefängnisses, das nur über einen extra in einer Ecke versteckten Eingang, vom Hof der Burg und für normale Besucher gar nicht zugänglich ist. Dieser Raum ist, wie auch andere Spuren zeigen, einer der ältesten der gesamten Allensteiner Burg. Laut Strużyński ist der Mühlstein damals direkt eingemauert worden – oberhalb des eigentlichen Lochs. Das bedeutet aber, so die Folgerung von Rafał Bętkowski vom Museum der Moderne in Allenstein, dass der Bau der Burg nicht bei Null begann, sondern es einen Vorgängerbau, vermutlich eine Holz-Erd-Festung, gegeben hat. „Es muss außerdem schon eine Mühle an der Alle existiert haben“, ergänzte Bętkowski, „das kann eine Wehrmühle gewesen sein, aber auf jeden Fall taucht sie in der Lokationsurkunde von Allenstein auf.“
In einer anderen Frage zum Mühlstein erlebten die Teilnehmer der Werkstatt jedoch eine Enttäuschung. Aufgrund seiner dunklen Farbe stand zur Debatte, der Stein könne vulkanisch und von weither, nämlich aus Andernach am Rhein, in die Region transportiert worden sein. „Der Stein ist nur wegen der Patina der Jahrhunderte so dunkel, es handelt sich dabei um einen grobkristallinen Granit finnischen Ursprungs, der hier als Findling typisch auftritt“, lautete das Urteil des Geologen Piotr Czubla von der Universität Lodsch, der damit dieser lebhaft diskutierten und interessanten Geschichte den Wind aus den Segeln nahm.
Quelle: PAZ Nr.5-3. Februar 2023
Fliegende Zigarren über Ostpreußen
Die Luftschiffhäfen in Seerappen, Diwitten und Königsberg
von Wolfgang Kaufmann
Mit Beginn des Ersten Weltkriegs wurden die damals äußerst populären Starrluftschiffe des Erfinders Ferdinand Graf von Zeppelin vom Heer und der Marine aufgekauft und für militärische Zwecke verwendet. Darüber hinaus erhielten die Streitkräfte ab August 1914 neue, direkt für den Kriegseinsatz konzipierte Zeppeline. Die Luftschiffe unternahmen zumeist Aufklärungsfahrten im Bereich der Ost- und der Westfront oder warfen Bomben auf Verkehrsanlagen und einige Städte des Feindes. Dabei nutzten sie auch drei Stützpunkte in Ostpreußen.
Der erste befand sich in dem Dorf Seerappen an der Bahnstrecke zwischen Pillau und Königsberg. Hier lagen die Zentrale des Marine-Luftschiffwesens für die östliche Ostsee sowie das Hauptquartier des Marine-Luftschifftrupps VI beziehungsweise der 2. Kompanie des Luftschiffer-Bataillons Nr. 2. Zur Unterbringung der Zeppeline entstand in Seerappen ab 1915 eine gigantische Halle von 7200 Quadratmetern Grundfläche und 35 Metern Höhe sowie 60 Metern Breite. Das Bauwerk, das von der Zeppelin Hallenbau GmbH errichtet wurde, konnte nach seiner Fertigstellung drei Militärluftschiffe mit Rumpflängen von rund 200 Metern gleichzeitig aufnehmen. Darüber hinaus gab es eine Anlage zur Herstellung von 12.000 Kubikmetern Wasserstoff pro Tag zur Füllung der Tragzellen der Zeppeline. Die Absicherung des Flugbetriebes der beiden Marine- und der vier Heeresluftschiffe, welche insgesamt von Seerappen aus operierten, erfolgte durch etwa 450 Mann Bodenpersonal.
Das bekannteste dieser sechs Luftschiffe war LZ 62, dem die Marine die taktische Bezeichnung L 30 gegeben hatte. Der erste aus einer Reihe von sogenannten „Superzeppelinen“ mit zwei zusätzlichen Motorgondeln und vergrößertem Rumpf unternahm 31 Aufklärungs- sowie zehn Angriffsfahrten und warf dabei 23 Tonnen Bomben ab. Er wurde im Mai 1917 von Tondern an der deutsch-dänischen Grenze nach Seerappen verlegt. Unter dem Kommando von Oberleutnant zur See Boedecker unterstützte das Luftschiff bis zum November 1917 die deutsche Kriegführung im Osten. Dann erfolgte seine Außerdienststellung.
Zwischen Königsberg und Berlin
Nach der Niederlage des Kaiserreiches übernahm die Ostdeutsche Landwerkstätten Seerappen GmbH das Gelände der vormaligen Zeppelin-Basis und organisierte ab Dezember 1920 regelmäßige Flüge zwischen Königsberg und Berlin. Später befand sich hier eine Fliegerschule der deutschen Luftwaffe, bevor dann ab März 1941 auch Kampfmaschinen des Zerstörergeschwaders 76 in Seerappen stationiert wurden.
Die zweite Luftschiffhalle in Ostpreußen stand in der Ortschaft Diwitten nördlich von Allenstein. Sie war 28 Meter hoch, 35 Meter breit und 191 Meter lang. Ihre Einweihung erfolgte 1914. In Diwitten lag die 1. Kompanie des Luftschiffer-Bataillons Nr. 5. Die spektakulärsten Einsätze von hier aus flog das frühere Verkehrsluftschiff LZ 17 „Sachsen“ unter dem Kommando von Hauptmann Fritz George beziehungsweise später dann Oberleutnant Ernst Scherzer. So warf es ab Februar 1915 mehrmals Bomben auf die gegnerischen Verkehrsanlagen in Białystok, Wilna und Ciechanów bei Warschau. Dazu kamen Angriffe auf die Forts von Łomża. Beim letzten Bombardement des Bahnhofs von Wilna traf LZ 17 einen Munitionszug, dessen Explosion erheblichen Schaden anrichtete. Die Halle für die „Sachsen“ und weitere Militärzeppeline musste 1921 aufgrund der Bestimmungen des Versailler Vertrages demontiert werden und erhielt später eine neue Verwendung in Darmstadt. Dort dient sie noch heute als Parkhaus.
Und auch in Königsberg befand sich eine Luftschiffhalle. Diese beherbergte ab August 1914 unter anderem die drei Heeres-Zeppeline Z IV (LZ 16), Z V (LZ 20) und LZ 34. Das riesige Gebäude war von der Betonbaufirma Rautenberg aus Berlin sowie dem Stahlbauunternehmen Seibert aus Saarbrücken errichtet und schon vor dem Krieg an die deutsche Heeresverwaltung übergeben worden. Die 170 Meter lange Halle mit ihren 36 Meter hohen und je 40 Tonnen schweren Torflügeln stand im Stadtteil Klein-Amalienau.
Verluste
Z IV (LZ 16) unter dem Kommando von Hauptmann von Quast wurde gleich zu Kriegsbeginn der 8. Armee zugeordnet und unternahm zunächst nächtliche Aufklärungsfahrten über der zaristischen Festung Osowiec. Bei Bombenangriffen auf Warschau und das russisch besetzte Lyck erhielt der Zeppelin mehrere Hundert Treffer und konnte wegen der so verursachten Rumpfschäden bald nur noch als Schulschiff verwendet werden. Z V (LZ 20) ging bereits im August 1914 während der Schlacht bei Tannenberg verloren, in deren Verlauf Hindenburgs VIII. Armee die ins südliche Ostpreußen eingedrungenen russischen Kräfte zerschlug. Aufgrund des hohen Gasverlustes durch den Beschuss während der Bombardierung der Bahnanlagen von Mława musste das Luftschiff im Feindesland niedergehen, wobei die Besatzung in Gefangenschaft geriet.
Mit einem Totalverlust endete auch die letzte Mission von LZ 34. Der Zeppelin erhielt am 21. Juni 1915 mehrere schwere Treffer und verbrannte dann beim Versuch, in Insterburg notzulanden.
Eiszeit in Ostpreussen - wie Kälteperioden die Landschaft veränderten
Grund- und Endmoränen, Schwemmland- und Höhenebenen – Das Eis formte Seen, Täler und Hügel
von Wolfgang Kaufmann
Die Landschaft in Ostpreußen, so wie der Mensch sie vorfand, als er im 11. Jahrtausend v. Chr. erstmals hier Fuß fasste, ist ein Produkt der Eiszeiten. In deren Verlauf kam es in den letzten 400.000 Jahren zu drei großen Vorstößen des Skandinavischen Inlandeises beziehungsweise Fennoskandischen Eisschildes, wobei die Eisgrenze mal etwas mehr und mal etwas weniger weit im Süden lag. Das Gebiet des heutigen Ostpreußen befand sich aber stets komplett oder zumindest fast vollständig unter dem bis zu drei Kilometer dicken Eispanzer.
Wormditt–Heilsberg–Angerburg
Die letzte Kaltzeit, die seit 1909 auf Vorschlag der Königlich-Preußischen Geologischen Landesanstalt als Weichsel-Kaltzeit bezeichnet wird, hatte mehrere Phasen. Dabei walzte das Eisschild während des Weichsel-Hochglazials zwischen etwa 20.000 und 16.000 v. Chr. über Ostpreußen hinweg, bis es sich dann erneut zurückzog, wonach schließlich der abrupte Temperaturanstieg um 9660 v. Chr. folgte. Zurück blieb eine typische, durch die sogenannte Glaziale Serie geprägte Landschaft. Deren Bestandteile sind vor allem Grundmoränen, bogenförmige Ketten von Endmoränen sowie vorgelagerte, von zahlreichen Seen durchsetzte Schwemmlandebenen aus Sand, Kies und Geröll.
Grundmoränen finden sich in Ostpreußen nördlich der Linie Wormditt–Heilsberg–Angerburg. Durch den gewaltigen Druck des Eises wurden die oberen Gesteinslagen zermalmt und es entstanden Unmengen von Geschiebemergel. Von Brunnenbauern vorgenommene Bohrungen zeigten, dass Mergelschichten von stellenweise bis zu 200 Metern Dicke auf dem Grundgestein liegen, was vom gigantischen Zerstörungswerk des Eisschildes kündet und erhebliche Konsequenzen für die spätere Landwirtschaft in Ostpreußen hatte: Rund 68 Prozent der Ackerböden der östlichsten deutschen Provinz sind tonig-lehmig und dadurch oft auch sehr schwer, weswegen sie vorrangig für den Anbau von Weizen und Rüben taugen.
Wenn sich unter dem Eis besonders hartes Gesteinsmaterial befand, dann wurde es nicht zermahlen, sondern nur rundgeschliffen. Solche Findlinge der verschiedensten Größen kamen später beim Bau von Burgen, Straßen und Hafenanlagen zum Einsatz, sofern man sie wegen ihres Gewichtes nicht an Ort und Stelle beließ wie den sagenumwobenen Borstenstein bei Neukuhren.
Die Kette der Endmoränen in Ostpreußen erstreckt sich in etwa entlang der Linie Neidenburg–Ortelsburg–Johannisburg. Im Gegensatz zu den flachwelligen ausgedehnten Grundmoränen, welche übrig blieben, als der darüber liegende Gletscher abschmolz, kennzeichnen die Endmoränen den Punkt des weitesten Vordringens des Eises. Dabei können sie eine beachtliche Höhe erreichen, wenn beim Vorstoß des Gletschers das vorhandene Bodenmaterial an der vorderen Eiskante aufgeworfen wurde.
Die Endmoränen in Ostpreußen sind Teil des Baltischen Landrückens, der sich südlich der Ostsee mit manchmal 200 Kilometern Breite von Jütland bis nach Estland zieht und im 329 Meter hohen Turmberg nahe der westpreußischen Stadt Berent gipfelt. Weiter östlich davon ragen die Kernsdorfer Höhe südwestlich von Allenstein und der Seesker Berg bei Goldap bis auf 312 beziehungsweise 309 Meter auf, was die Kernsdorfer Höhe zum höchsten Berg Ostpreußens macht. Hier kann sogar Wintersport betrieben werden: Steile Abfahrten und ein Skilift sind vorhanden. Ebenfalls zum Skifahren taugt der 111 Meter hohe Galtgarben in der Moränenlandschaft des samländischen Alkgebirges.
Ein weiteres Erbe der Eiszeit stellen die Masurische und die Eylauer Seenplatte dar. Diese entstanden beim Abschmelzen der Gletscher, als das Wasser zuerst allerlei Senken in den Boden grub und sich dann darin sammelte. Dabei riss es auch jede Menge Sand mit, der rund um die Gewässer sowie allgemein im flachen Vorfeld der Endmoränen liegen blieb, wo man nun für die Landwirtschaft weitgehend ungeeignete Gebiete wie die Rominter Heide mit ihren ausgedehnten Kiefernwäldern findet.
Die Küstenlinie der Ostsee entstand
Dann bildete sich zum Ausgang der Weichsel-Kaltzeit auch noch die heutige, 220 Kilometer lange Küstenlinie von Ostpreußen heraus. Mit dem Abtauen des Fennoskandischen Eisschildes entstand die Ostsee, wobei dieser Prozess von etwa 10.000 v. Chr. bis 500 n. Chr. andauerte. Zunächst flossen die Schmelzwässer der Gletscher bis 8500 v. Chr. im Großen Baltischen Eisstausee zusammen. Dann verband dieser sich zwischen 8000 und 7700 v. Chr. mit der Nordsee, wodurch das Yoldia-Meer entstand. Das wiederum mutierte infolge der Hebung Skandinaviens nach dem Wegfall des Drucks seitens des Fennoskandischen Eisschildes zu einem Binnenmeer, genannt Ancylus-See, welches bis 6000 v. Chr. existierte. Anschließend strömte wieder Salzwasser aus der Nordsee ein, was die Geburtsstunde des Littorina-Meeres war, aus dem sich in den letzten 2000 Jahren die heutige Ostsee entwickelte.
Parallel zu der immer noch stattfindenden Hebung Skandinaviens um aktuell neun Millimeter pro Jahr findet an der ostpreußischen Küste eine ausgleichende Absenkung statt, weswegen das Bild der Landschaft auch in der Zukunft sichtbare Veränderungen erfahren wird.
Wie deutsche Ortsnamen verschwanden- Umbenennungen in Ostpreussen
Lötzen erhielt innerhalb eines Jahres zwei weitere Namen – Orientierung meist an Persönlichkeiten
von Wolfgang Reith
Sensburg gilt als die Stadt Ostpreußens, in der es am spätesten Frühling und am ehesten Herbst wird. Sensburg ist zugleich eine der wenigen Städte im südlichen Teil Ostpreußens, die nach dem Zweiten Weltkrieg statt der historischen polnischen Bezeichnung einen völlig neuen Namen – zu Ehren von Vorkämpfern des Polen- beziehungsweise Masurentums – erhielten. 1945 wurde Sensburg zunächst in Ządźbork (alte masurische Bezeichnung) umbenannt, seit 1947 heißt es jedoch Mrągowo – nach dem evangelischen Pfarrer und Lehrer Christoph Coelestin Mrongovius (1764–1855), der in Danzig wirkte und sich 1842 mit einer Petition an den preußischen König wandte, in der er sich mit Erfolg gegen die Germanisierung in den Schulen beziehungsweise für die Beibehaltung des Masurischen als Unterrichtssprache einsetzte.
Nachdem die Rote Armee 1945 den größten Teil Ostpreußens besetzt hatte, übergab die sowjetische Militäradministration ab Mai des Jahres die Verwaltung in die Hände der Polen, die sich in zunehmender Zahl ansiedelten. Am 13. November 1945 wurde ein „Ministerium für die wiedergewonnenen Gebiete“ etabliert, das am 7. Mai 1946 im Zusammenwirken mit dem Ministerium für öffentliche Verwaltung eine Verordnung über die Umbenennung der deutschen Ortsbezeichnungen erließ und deren amtliche polnische Schreibweise festlegte. Bis dahin waren die meisten deutschen Ortsnamen provisorisch ins Polnische übersetzt worden.
So hatte Angerburg die Bezeichnung Węgobork erhalten, Johannisburg hieß nun Jańsbork, Neidenburg Nidbork, aus Rastenburg war Rastembork, aus Sensburg Ządźbork und aus Wartenburg Wartembork geworden. Mit der neuen Verordnung änderte sich dies, und noch am Tag ihrer Verkündung erfolgte die Umbenennung von Węgobork in Węgorzewo, von Jańsbork in Pisz, von Nidbork in Nidzica und von Rastenburg in Kętrzyn. Wartembork zog am 4. Dezember 1946 nach und änderte seinen Namen in Barczewo. Lötzen hingegen hatte bereits am 4. März 1946 die Bezeichnung Giżycko erhalten, während Ządźbork erst nach längeren Diskussionen am 26. Oktober 1947 den festgesetzten neuen Namen Mrągowo annahm.
Węgorzewo leitet sich vom polnischen Wort „Węgorz“ ab, das für „Aal“ steht und ein Verweis darauf ist, dass dieser Fisch hier häufig gefangen wird. Durch Nidzica fließt die Neide [Nide], die der Stadt den Namen gab, und Pisz geht auf das Flüsschen Pissa [Pisa Galinda] beziehungsweise [Pisa Warmińska] zurück, das im benachbarten Pisz-See entspringt.
Die übrigen genannten Städte bekamen völlig neue Namen. So erhielt Rastenburg/Rastembork den Namen Kętrzyn zu Ehren von Wojciech Kętrzyński, bei dem es sich eigentlich um den 1838 in Lötzen geborenen Adalbert von Winkler handelte. Seine Mutter war Deutsche, sein Vater kaschubisch-polnischer Herkunft. Während der Gymnasialzeit in Rastenburg und des nachfolgenden Geschichtsstudiums an der Königsberger Albertina „entdeckte“ er seine polnischen Wurzeln und führte seit 1861 den polnischen Namen, den er wörtlich übersetzt hatte. Von 1873 bis zu seinem Tod 1918 wirkte er als Direktor der historischen Sammlungen am Ossolineum in Lemberg. Seine 1872 erschienene Schrift „Über Masuren“ bildete die Grundlage für den Anspruch Polens auf die Region.
Wartenburg [Wartembork] erhielt die Bezeichnung Barczewo nach dem katholischen Geistlichen Walenty (Valentin) Barczewski (1856–1928), der sich als Mitglied des Provinziallandtages von Ostpreußen wie auch des Zentralkomitees der Polen im Deutschen Reich für die polnische Sprache in seiner Heimat einsetzte.
Einsatz für die masurische Sprache
Giżycko für Lötzen leitet sich ab vom Familiennamen des Gustav Gisevius (1810–1848), der Pfarrer an der Polnischen Kirche in Osterode war und sich maßgeblich der Bewahrung der masurischen Kultur verschrieb. 1834 hielt er sich eine Zeitlang in Lötzen auf und war 1842 dort Mitbegründer der ersten weltlichen Zeitschrift Masurens. Sowohl Gisevius als auch Mrongovius setzten sich zwar für den Erhalt der polnischen/masurischen Sprache und Kultur ein, machten aber andererseits deutlich, dass sie sich als preußische Staatsbürger fühlten und in Loyalität zum preußischen König standen, was in der polnischen Masurenpropaganda gerne unterschlagen wird. So erkannte die Gruppe masurischer Pfarrer, der beide angehörten, durchaus die Notwendigkeit deutschen Sprachunterrichts in den Schulen an.
Für Lötzen war die Umbenennung in Giżycko die dritte innerhalb eines Jahres. Unmittelbar nach dem Einmarsch der Roten Armee Ende Januar 1945 erhielt die Stadt den alten polnischen/masurischen Namen Lec, doch bereits im August desselben Jahres wurde dieser durch Łuczany ersetzt. Die erneute Umbenennung am
4. März 1946, die unter anderem wegen einer möglichen Verwechslung mit Rudczanny erfolgte (das aber schon am 16. Juli 1938 in Niedersee umbenannt worden war und 1945 den Namen Ruciane erhielt), stieß auf nicht ungeteilte Zustimmung in der Bevölkerung, und so lebt der alte Name bis heute fort im Lötzener Kanal [Kanał Łuczański], der in den Jahren 1765 bis 1772 erbaut wurde und den Löwentin- mit dem Kissainsee verbindet. Ebenso verwenden einige gastronomische Einrichtungen und die Verkehrsbetriebe der Stadt bis heute den alten Namen weiter. Seit einigen Jahren führt sogar die Weiße Flotte auf ihren Schiffen gelegentlich beide Bezeichnungen (Giżycko und Łuczany) mit dem Hinweis „Herz Masurens“.
Polens Ansprüche auf Ostpreußen
Die erwähnte Verordnung vom 7. Mai 1946, mit der die polnischen Ortsnamen festgelegt wurden, bezog sich auf eine entsprechende Verordnung des Präsidenten der Republik Polen vom 24. Oktober 1934. In jenem Jahr erschienen in Warschau Regionalkarten für ganz Ostpreußen, die den historischen und kulturellen „Anspruch“ Polens auf das Gebiet untermauern sollten. Darin findet man auch die polnischen Bezeichnungen für Städte und Kreise, die heute im russischen, nördlichen Teil Ostpreußens liegen (etwa Królewiec für Königsberg, Gąbin Pruski für Gumbinnen oder Wystruć für Insterburg). Die Regionalkarten waren Teil einer größeren Ausgabe, die den Titel „Deutschland, Preußen, Ostpreußen“ („Niemcy, Prusy, Prusy Wschodnie“) trug, wobei das zentrale Gebiet als „Preußisch Masuren“ („Mazury Pruskie“) ausgewiesen war.
1995 wurden Nachdrucke dieser Karten veröffentlicht. Während die Originale von 1934 weitgehend die deutschen Ortsbezeichnungen enthalten, wobei auch die alten masurischen Namen eingetragen sind, erscheinen in dem Nachdruck von 1995 hinter den deutschen Ortsnamen jeweils in Rot die heutigen polnischen Bezeichnungen (also für Lötzen „Giżycko“, für Sensburg „Mrągowo“ oder für Rastenburg „Kętrzyn“). In der Ortsbeschreibung für Lötzen werden überdies alle früher gebräuchlichen oder in Urkunden verwendeten Namen der Stadt aufgeführt: Lece, Loczany, Lecko, Lehtczem, Letzkenborg, Lesken, Leeczen, Leitcze, aber auch Lötzen und Neuendorf.
Eine letzte Namensänderung erfolgte übrigens 1950, als das Städtchen Drengfurt(h), das 1946 die polonisierte Ortsbezeichnung Dryfort erhalten hatte, in Srokowo umbenannt wurde. Damit ehrte man den im selben Jahr verstorbenen polnischen Geographen und Diplomaten Stanisław Srokowski (1872–1950), der von 1946 bis zu seinem Tod als Leiter des Komitees zur Festsetzung von Ortsnamen in Polens „wiedergewonnenen Gebieten“ fungierte.
Ostern
Vom Schmackostern und Wasserholen
Vom Schmackostern und Wasserholen
Ostpreußische Bräuche von Gründonnerstag bis Ostermontag – Wie das Fest in der Literatur beschrieben wurde
Bärbel Beutner
 Vielleicht lag es an dem langen ostpreußischen Winter, dass Ostern in Ostpreußen eine besondere Bedeutung hatte. Andererseits werden Frühlingsfeste in allen Kulturen seit Jahrtausenden opulent gefeiert. Man begrüßt das neue Leben, die wiedererwachende Natur. Im Judentum wird das Passah-Fest zum Gedenken an den Auszug aus Ägypten gefeiert. Der Opfertod Christi und vor allem seine Auferstehung fanden am Passah-Fest in Jerusalem statt und machte Ostern zum höchsten christlichen Fest des Jahres. Viele Bräuche kommen aus heidnischen Kulturen, und in Ostpreußen haben sie sich bis zur Vertreibung erhalten, besonders auf dem Lande. Hedwig von Lölhöffel-Tharau hat die Bräuche gesammelt, und Hanna Wangerin, die langjährige Kulturreferentin der Landsmannschaft Ostpreußen, gab ein Arbeitsheft heraus, aus dem die folgenden Angaben stammen. Die Karwoche hielt schon manches typische Brauchtum bereit. Das Wort „Karwoche“ soll von dem althochdeutschen Wort „Kara“ für „Trauer“ und „Klage“ kommen, wie es in dem Buch „Feste und Bräuche“ von Sybil Gräfin Schönfeldt, Ravensburg 1987, nachgelesen werden kann. In Ostpreußen backte man am Gründonnerstag den „Gründonnerstagskringel“, ein Hefekuchen, der das ganze Backblech einnahm. Er symbolisiert die Fessel, mit der Jesus gebunden wurde. Der Kringel wurde mitunter mit Birkengrün geschmückt und dann gemeinsam gegessen. Dabei gab es verschiedene Traditionen. So zogen in Mehlsack alle Anwesenden an dem Kringel, und wer das größte Stück bekam, durfte sich etwas wünschen. Der Wunsch sollte in Erfüllung gehen. Woanders wurde der Kringel sittsam aufgeschnitten, bevor alle „ran durften“. Die Farbe Grün dominierte am Gründonnerstag in vielen Gegenden, auch bei den Speisen. Man aß Grünkohl und grüne Suppe mit Kräutern und grüne Pfannkuchen. Am Gründonnerstag sollte man in Ostpreußen, wenn draußen alles zu grünen begann, im Garten pflanzen, die Obstbäume beschneiden und säen, das garantierte eine gute Ernte.Dabei geht das Wort „grün“ auf das mittelhochdeutsche „greinen“, das heißt, „weinen“ und „klagen“ zurück. Daraus wurde „Greindonnerstag“ und schließlich „Gründonnerstag“. In Ostpreußen aber hatte sich das Wort „greinen“ erhalten. „Was greinerst nu?“, wurde gefragt, wenn Tränen nicht unbedingt angebracht waren. Wasser spielte bei allen Bräuchen in Ostpreußen eine wichtige Rolle. In der Ballade „Das Opfer“ von Agnes Miegel bringen die bedrängten Samländer, obwohl sie schon längst Christen sind, dem Meeresgott einen Widder zum Opfer, und sie beten: „Du, aus dessen Samen dies Land und wir alle gekommen“. Aus dem Wasser ist also das Leben entstanden, zum Leben ist es nötig, für die Fruchtbarkeit und die Lebenserhaltung. Dem Osterwasser wurden nicht nur heilende Kräfte zugeschrieben. Es musste am Ostermorgen bei Sonnenaufgang aus einem fließenden, klaren Wasser geschöpft werden – die Aufgabe der jungen Mädchen. Bei dem Gang zum Wasserschöpfen durften sie nicht sprechen und nicht lachen und sich nicht umschauen, bis sie mit dem vollen Krug wieder nach Hause kamen. Das Osterwasser diente unter anderem der Schönheit, und es konnte sogar geschehen, dass im Fluss oder Bach das Bild des Zukünftigen erschien. Mädchen und Frauen wurden auch mit Wasser begossen, das diente der Fruchtbarkeit. Es ist ebenfalls ein polnischer Osterbrauch. Im Ermland, in Masuren und in Klein-Litauen verjagte man in der Woche vor Ostern den „Rasemuck“, eine Art Kobold, der auf der Lucht, also auf dem Dachboden der Scheune hauste. Die Mädchen mussten ihn mit der Schürze auffangen und bekamen dabei einen Wasserguss über den Kopf. Hier fand offenbar ein letztes Winteraustreiben statt. Der Rasemuck musste raus, damit der Boden für die neue Ernte frei und „rein“ war.Eine Art Winteraustreiben gab es auch in Schlesien, aber in christlicher Form als „Judas-Austreiben“. Ein junger Mann in roter Weste wurde in der Karwoche mit viel Lärm aus der Kirche getrieben, ein großer Spaß für die Jugend. War der Ostersonntag da, spielte natürlich die Eiersuche eine große Rolle. Buntgefärbte Eier gab es in China schon vor 5000 Jahren, ebenso im alten Ägypten. Das Ei ist das wichtigste Fruchtbarkeitssymbol. In Ostpreußen versteckte wie anderenorts der Hase die Ostereier. Es soll den Osterhasen erst seit dem 16. Jahrhundert geben, aber der Hase war in der Antike das Tier der Liebesgöttin Aphrodite, also für die Fruchtbarkeit zuständig. Das hängt wohl mit seiner reichen und raschen Nachkommenschaft zusammen. Im germanischen Bereich soll er Begleiter der Erdgöttin Holda, aber auch der Frühlingsgöttin Ostara sein, von der sich das Wort „Ostern“ ableitet. Ein typisch ostpreußischer Brauch war das „Schmackostern“. Am Morgen des Ostersonntags, wenn noch alle in den Betten lagen, kamen Kinder mit Ruten aus Weiden oder Birken und schlugen den Schlafenden auf die Beine und Füße. Das sollte die Lebensgeister wecken und Gesundheit bringen. Auch das ist ein altes Fruchtbarkeits- und Reinigungsritual, wie das Wassergießen und Untertauchen. Die Kinder sagten dabei: „Oster, schmackoster, bunt Oster,/fief Eier, Stück Speck,/vom Koke de Eck,/eh’r goh wi nich weg!“ Das muss wohl nicht übersetzt werden. Es handelt sich hier um einen „Heischegang“. Die Kinder wollen etwas „erheischen“, also erbetteln, Eier und Speck und Süßigkeiten, eben eine Ecke vom Kuchen. Natürlich mussten auch in Ostpreußen zu Ostern, Haus und Hof gründlich gereinigt und aufgeräumt werden. Und das Festessen spielte eine große Rolle, wie überall. Die Russen backen die „Kulitschki“, Osterkuchen aus einem üppigen Hefeteig mit in Rum gequollenen Rosinen und dickem Zuckerguss. Eine lange und aufwendige Zubereitung ist dafür nötig. Als festliche Ostertorte könnte es in Ostpreußen die „Louisen-Torte“ gegeben haben, für die Hans-Joachim Engel in seiner bibliophilen Schrift „Reisen & Speisen mit Königin Louise“ das Rezept verrät: „Zutaten: 180 g Butter, 150 g Zucker, 6 El. Sauermilch, 1 Pfd. Mehl, dazu abgeriebene Zitronenschale sowie 1 Päckchen Backpulver. Zur Füllung: Vanillecreme, Schokoladencreme und Himbeerkonfitüre.“ Damit ahnt man schon, dass hier ein Kunstwerk entstehen soll. Das bestätigt die Backanleitung: „Butter schaumig rühren, Zucker, Mehl, Zitronenschale und Backpulver zugeben, alles zusammenarbeiten und daraus vier runde Tortenböden backen. Nach dem Abkühlen den ersten Boden mit Vanillecreme bestreichen, den zweiten Boden darauf legen, mit Himbeerkonfitüre oder Gelee „Rouge“ (ein Dessert aus Sauerkirsch-Saft, Himbeeren, Gelierzucker und Himbeergeist) bestreichen, darauf den vierten Boden geben und mit Vanille- und Schokoladencreme ansehnlich verzieren und mit frischen Himbeeren oder Konfitüre dekorieren.“ Zur Zeit von Königin Luise wurden wohl noch keine Kalorien gezählt. Stattdessen schuf man kunstvolle Torten und genoss. So wünschte man sich „Frohe Ostern!“
Vielleicht lag es an dem langen ostpreußischen Winter, dass Ostern in Ostpreußen eine besondere Bedeutung hatte. Andererseits werden Frühlingsfeste in allen Kulturen seit Jahrtausenden opulent gefeiert. Man begrüßt das neue Leben, die wiedererwachende Natur. Im Judentum wird das Passah-Fest zum Gedenken an den Auszug aus Ägypten gefeiert. Der Opfertod Christi und vor allem seine Auferstehung fanden am Passah-Fest in Jerusalem statt und machte Ostern zum höchsten christlichen Fest des Jahres. Viele Bräuche kommen aus heidnischen Kulturen, und in Ostpreußen haben sie sich bis zur Vertreibung erhalten, besonders auf dem Lande. Hedwig von Lölhöffel-Tharau hat die Bräuche gesammelt, und Hanna Wangerin, die langjährige Kulturreferentin der Landsmannschaft Ostpreußen, gab ein Arbeitsheft heraus, aus dem die folgenden Angaben stammen. Die Karwoche hielt schon manches typische Brauchtum bereit. Das Wort „Karwoche“ soll von dem althochdeutschen Wort „Kara“ für „Trauer“ und „Klage“ kommen, wie es in dem Buch „Feste und Bräuche“ von Sybil Gräfin Schönfeldt, Ravensburg 1987, nachgelesen werden kann. In Ostpreußen backte man am Gründonnerstag den „Gründonnerstagskringel“, ein Hefekuchen, der das ganze Backblech einnahm. Er symbolisiert die Fessel, mit der Jesus gebunden wurde. Der Kringel wurde mitunter mit Birkengrün geschmückt und dann gemeinsam gegessen. Dabei gab es verschiedene Traditionen. So zogen in Mehlsack alle Anwesenden an dem Kringel, und wer das größte Stück bekam, durfte sich etwas wünschen. Der Wunsch sollte in Erfüllung gehen. Woanders wurde der Kringel sittsam aufgeschnitten, bevor alle „ran durften“. Die Farbe Grün dominierte am Gründonnerstag in vielen Gegenden, auch bei den Speisen. Man aß Grünkohl und grüne Suppe mit Kräutern und grüne Pfannkuchen. Am Gründonnerstag sollte man in Ostpreußen, wenn draußen alles zu grünen begann, im Garten pflanzen, die Obstbäume beschneiden und säen, das garantierte eine gute Ernte.Dabei geht das Wort „grün“ auf das mittelhochdeutsche „greinen“, das heißt, „weinen“ und „klagen“ zurück. Daraus wurde „Greindonnerstag“ und schließlich „Gründonnerstag“. In Ostpreußen aber hatte sich das Wort „greinen“ erhalten. „Was greinerst nu?“, wurde gefragt, wenn Tränen nicht unbedingt angebracht waren. Wasser spielte bei allen Bräuchen in Ostpreußen eine wichtige Rolle. In der Ballade „Das Opfer“ von Agnes Miegel bringen die bedrängten Samländer, obwohl sie schon längst Christen sind, dem Meeresgott einen Widder zum Opfer, und sie beten: „Du, aus dessen Samen dies Land und wir alle gekommen“. Aus dem Wasser ist also das Leben entstanden, zum Leben ist es nötig, für die Fruchtbarkeit und die Lebenserhaltung. Dem Osterwasser wurden nicht nur heilende Kräfte zugeschrieben. Es musste am Ostermorgen bei Sonnenaufgang aus einem fließenden, klaren Wasser geschöpft werden – die Aufgabe der jungen Mädchen. Bei dem Gang zum Wasserschöpfen durften sie nicht sprechen und nicht lachen und sich nicht umschauen, bis sie mit dem vollen Krug wieder nach Hause kamen. Das Osterwasser diente unter anderem der Schönheit, und es konnte sogar geschehen, dass im Fluss oder Bach das Bild des Zukünftigen erschien. Mädchen und Frauen wurden auch mit Wasser begossen, das diente der Fruchtbarkeit. Es ist ebenfalls ein polnischer Osterbrauch. Im Ermland, in Masuren und in Klein-Litauen verjagte man in der Woche vor Ostern den „Rasemuck“, eine Art Kobold, der auf der Lucht, also auf dem Dachboden der Scheune hauste. Die Mädchen mussten ihn mit der Schürze auffangen und bekamen dabei einen Wasserguss über den Kopf. Hier fand offenbar ein letztes Winteraustreiben statt. Der Rasemuck musste raus, damit der Boden für die neue Ernte frei und „rein“ war.Eine Art Winteraustreiben gab es auch in Schlesien, aber in christlicher Form als „Judas-Austreiben“. Ein junger Mann in roter Weste wurde in der Karwoche mit viel Lärm aus der Kirche getrieben, ein großer Spaß für die Jugend. War der Ostersonntag da, spielte natürlich die Eiersuche eine große Rolle. Buntgefärbte Eier gab es in China schon vor 5000 Jahren, ebenso im alten Ägypten. Das Ei ist das wichtigste Fruchtbarkeitssymbol. In Ostpreußen versteckte wie anderenorts der Hase die Ostereier. Es soll den Osterhasen erst seit dem 16. Jahrhundert geben, aber der Hase war in der Antike das Tier der Liebesgöttin Aphrodite, also für die Fruchtbarkeit zuständig. Das hängt wohl mit seiner reichen und raschen Nachkommenschaft zusammen. Im germanischen Bereich soll er Begleiter der Erdgöttin Holda, aber auch der Frühlingsgöttin Ostara sein, von der sich das Wort „Ostern“ ableitet. Ein typisch ostpreußischer Brauch war das „Schmackostern“. Am Morgen des Ostersonntags, wenn noch alle in den Betten lagen, kamen Kinder mit Ruten aus Weiden oder Birken und schlugen den Schlafenden auf die Beine und Füße. Das sollte die Lebensgeister wecken und Gesundheit bringen. Auch das ist ein altes Fruchtbarkeits- und Reinigungsritual, wie das Wassergießen und Untertauchen. Die Kinder sagten dabei: „Oster, schmackoster, bunt Oster,/fief Eier, Stück Speck,/vom Koke de Eck,/eh’r goh wi nich weg!“ Das muss wohl nicht übersetzt werden. Es handelt sich hier um einen „Heischegang“. Die Kinder wollen etwas „erheischen“, also erbetteln, Eier und Speck und Süßigkeiten, eben eine Ecke vom Kuchen. Natürlich mussten auch in Ostpreußen zu Ostern, Haus und Hof gründlich gereinigt und aufgeräumt werden. Und das Festessen spielte eine große Rolle, wie überall. Die Russen backen die „Kulitschki“, Osterkuchen aus einem üppigen Hefeteig mit in Rum gequollenen Rosinen und dickem Zuckerguss. Eine lange und aufwendige Zubereitung ist dafür nötig. Als festliche Ostertorte könnte es in Ostpreußen die „Louisen-Torte“ gegeben haben, für die Hans-Joachim Engel in seiner bibliophilen Schrift „Reisen & Speisen mit Königin Louise“ das Rezept verrät: „Zutaten: 180 g Butter, 150 g Zucker, 6 El. Sauermilch, 1 Pfd. Mehl, dazu abgeriebene Zitronenschale sowie 1 Päckchen Backpulver. Zur Füllung: Vanillecreme, Schokoladencreme und Himbeerkonfitüre.“ Damit ahnt man schon, dass hier ein Kunstwerk entstehen soll. Das bestätigt die Backanleitung: „Butter schaumig rühren, Zucker, Mehl, Zitronenschale und Backpulver zugeben, alles zusammenarbeiten und daraus vier runde Tortenböden backen. Nach dem Abkühlen den ersten Boden mit Vanillecreme bestreichen, den zweiten Boden darauf legen, mit Himbeerkonfitüre oder Gelee „Rouge“ (ein Dessert aus Sauerkirsch-Saft, Himbeeren, Gelierzucker und Himbeergeist) bestreichen, darauf den vierten Boden geben und mit Vanille- und Schokoladencreme ansehnlich verzieren und mit frischen Himbeeren oder Konfitüre dekorieren.“ Zur Zeit von Königin Luise wurden wohl noch keine Kalorien gezählt. Stattdessen schuf man kunstvolle Torten und genoss. So wünschte man sich „Frohe Ostern!“Quelle: PAZ Nr.14-6 April 2023
Pfingsten in Ostpreussen - Von Maien, Alwieteschaukel und Kalmus
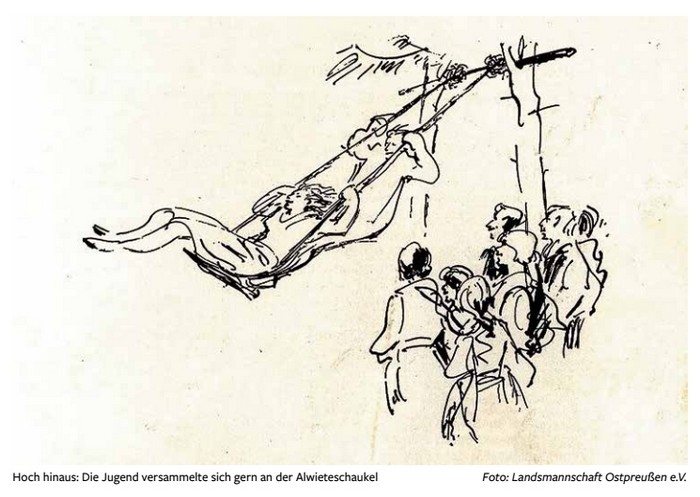 In Ostpreußen gab es besondere Pfingstbräuche, die Hedwig von Lölhöffel-Tharau in dem Arbeitsbrief der Landsmannschaft Ostpreußen „Vom Festefeiern in Ostpreußen“ festgehalten hat. Zu Pfingsten wurde das Haus mit Birkenzweigen geschmückt, genannt „die Maien“, die einen frischen Duft verströmten. Noch intensiver duftete der Kalmus, der auf den Dielen des Fußbodens ausgestreut wurde. Diese Pflanze stammt aus Asien, ein „Aronstabgewächs mit sumpfgrasähnlichen Blättern und einem Zapfen grüner Blütchen, der einem blattähnlichen Schaft seitlich entragt. Die Pflanze, die aus Asien stammt, wird in der Brockhaus-Enzyklopädie beschrieben. Aus dem Kalmus gewannen schon die Babylonier und Ägypter Medizin und Parfüm. In Ostpreußen fand diese Schilfpflanze gute Bedingungen vor und kam, kleingehackt und Duft verströmend, an Pfingsten zu hohen Ehren.
In Ostpreußen gab es besondere Pfingstbräuche, die Hedwig von Lölhöffel-Tharau in dem Arbeitsbrief der Landsmannschaft Ostpreußen „Vom Festefeiern in Ostpreußen“ festgehalten hat. Zu Pfingsten wurde das Haus mit Birkenzweigen geschmückt, genannt „die Maien“, die einen frischen Duft verströmten. Noch intensiver duftete der Kalmus, der auf den Dielen des Fußbodens ausgestreut wurde. Diese Pflanze stammt aus Asien, ein „Aronstabgewächs mit sumpfgrasähnlichen Blättern und einem Zapfen grüner Blütchen, der einem blattähnlichen Schaft seitlich entragt. Die Pflanze, die aus Asien stammt, wird in der Brockhaus-Enzyklopädie beschrieben. Aus dem Kalmus gewannen schon die Babylonier und Ägypter Medizin und Parfüm. In Ostpreußen fand diese Schilfpflanze gute Bedingungen vor und kam, kleingehackt und Duft verströmend, an Pfingsten zu hohen Ehren. Aus Weiden und Birken geflochten
„Maibaum“ und „Pfingstochse“ sind allgemein bekannt, aber die „Alwieteschaukel“ traf man nur in Ostpreußen und wohl auch in Litauen an. „Alwieten sind ein weidenartiges Gebüsch mit recht schmalen Blättern, dessen Triebe von ungeheurer Widerstandsfähigkeit sind“, berichtet ein Landsmann aus der Tilsiter Gegend. Zwei junge Birkenbäume von etwa vier Metern Länge mit guten Baumkronen wurden herbeigeschafft und die Kronen mit den Alwieten zu Kränzen verflochten. Durch diese Kränze schob man ein Rundholz, etwa 2,5 Meter lang. Die Stämme waren die Stangen der Schaukel, die nun zwischen zwei kräftigen Kiefernstämmen in dem Kronengehölz befestigt wurde. Am unteren Ende der Birkenstangen brachte ein Sitzbrett an. Auf dieser Schaukel nahmen vor allem Liebespaare Platz. Das Mädchen setzte sich hin, der Bursche stellte sich dahinter und versuchte, seine Auserwählte möglichst hoch zu schwingen. Sogar ein Überschlag wurde mitunter angestrebt. Die Weidengerte (litauisch „alwite“) soll lebensspendende Kraft haben – für junge Paare ein wichtiger Punkt. In Agnes Miegels Ballade „Das Märchen von der schönen Mete“ vollzieht sich an Pfingsten eine tiefe Erneuerung. Die schöne Mete ist ein Findelkind, das nackt vor der Tür des Schulzen gelegen hat. Der Sohn des Schulzen liebt die herangewachsene Schönheit und nimmt sie zur Frau. Ihre Herkunft bleibt dunkel. „Und würde deine Mutter eine Hexe sein,/Du wunderschöne Mete, Dich nur will ich frein!“ An Pfingsten trägt die schöne Mete ihr Kind zur Taufe, als der „Großknecht am Tore die Maien anschlug“. Da bricht die Geisterwelt oder das Heidentum über Mete herein. Sie kommt aus dem Elfenland, bereut bitter ihre Liebe zu einem Sterblichen und will zurück zu ihren Schwestern mit den „grünfunkelnden Augen“. Doch ihr Mann hält sie fest und besiegt den Zauber mit der Kraft seiner Liebe. Mete lässt das „Elfenland“ endgültig zurück und gehört nun zu ihrem „liebsten Mann“ und zu ihrem Kind. „Wie läuten die Glocken lieblich im Heimatland!“ Das Heidentum brach sich auch in der Johannisnacht in Ostpreußen Bahn. Die heidnische Sonnenwendfeier in der Mittsommernacht bekam bei der Christianisierung den Bezug zu Johannes dem Täufer. Seit dem 12. Jahrhundert sind die Johannisfeuer in Europa bezeugt, aber auch Wasser spielte eine Rolle ähnlich wie zu Ostern. Reinigung und Erneuerung ergeben sich durch Wasser und durch Feuer.
Zwischen Heiden- und Christentum
Das Wissen um die Heilkraft der Natur vererbten die alten Prußen an ihre christlichen Nachfolger. Heilkräuter sollten vor der Sommersonnenwende geerntet werden, weil die Wirkung sich später abschwächt. „So sammelte man in Natangen und im Samland neunerlei Kräuter und flocht sie in der Johannisnacht zum Kranz“, schildert Hedwig von Lölhöffel. Schafgarbe, Johanniskraut, Kamille, Labkraut, Schachtelhalm waren dabei. Man legte sie, zum Kranz geflochten, unter das Kopfkissen. Der Traum in der Johannisnacht ging dann in Erfüllung. In der frühen Ballade „Elfkönig“ (1900) erwähnt Agnes Miegel diesen Brauch. „Johannisabend im Vollmondschein,/Neunerlei Kräuter sucht ich am Rain“. Das Johannisfeuer wurde auf verschiedene Weise abgebrannt. Im Kreis Darkehmen wurde ein Wagenrad mit Teer bestrichen und mit Tannenästen umwunden. In der Tilsiter Gegend steckte man Hafer und Stroh in ein großes Fass, goss Teer hinein und befestigte das Fass an einem Pfahl. Der wurde in die Erde gegraben,und die Leute tanzten um das lodernde Feuer. Das Johannisfeuer sollte Unwetter vom ganzen Land abhalten.
Allensteiner Welle
Radio hält zusammen
Start vor 21 Jahren: Der deutschsprachige Sender bietet Unterhaltung und Informationen für die Deutsche Minderheit
Viele deutsche Gesellschaften im südlichen Ostpreußen wurden und werden 30 Jahre alt. Im April 2021 gab es auch für die Radiosendung für die Deutsche Minderheit in der Woiwodschaft Ermland-Masuren „Allensteiner Welle“ ein Jubiläum: Sie wurde 20. Gefeiert wurde jedoch (noch) nicht.
Es hörte sich vor 21 Jahren wie ein Aprilscherz an; die Mitglieder der Deutschen Minderheit wollten es erst nicht so recht glauben. Im Rückblick lässt sich aber feststellen: Der 1. April 2001 war ein Meilenstein für den Verband der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren VdGEM. Damals ging die „Allensteiner Welle“ zum ersten Mal auf Sendung, um 18.05 Uhr, 15 Minuten lang und zweisprachig moderiert. Thema war ein Theaterstück zu Don Quijote, das auf Deutsch im Allensteiner Stefan-Jaracz-Theater gastierte.
 Es war ein eifriges und gut vorbereitetes Team unter Leitung von Arkadiusz Łuba, mit dem damals die Sendung gestaltet wurde. Viele Mitarbeiter kamen und gingen im Lauf der Jahre, die Sendung wuchs auf 25 Minuten und wurde auf 20.05 Uhr verschoben.
Es war ein eifriges und gut vorbereitetes Team unter Leitung von Arkadiusz Łuba, mit dem damals die Sendung gestaltet wurde. Viele Mitarbeiter kamen und gingen im Lauf der Jahre, die Sendung wuchs auf 25 Minuten und wurde auf 20.05 Uhr verschoben. Geblieben ist die Struktur der „Allensteiner Welle“: ein kurzer Nachrichtenblock am Anfang, danach Beiträge, Interviews, Berichte und Feuilletons, einmal im Monat ein Wunschkonzert am Ende der Sendung. Der thematische Schwerpunkt liegt auf Ereignissen bei der regionalen Deutschen Minderheit und Themen, die sie betreffen. Dazu kommen deutsch-polnische Fragen, Themen zur deutschen Sprache und Kultur sowie Berichte zu aktuellen Anlässen.
„Im Moment können wir wenig aus den Gesellschaften der Deutschen Minderheit präsentieren“, bedauert die leitende Redakteurin Anna Przywoźna, die von Anfang an bei der „Allensteiner Welle“ dabei ist, „nachdem die Einschränkungen zur Pandemie gelockert wurden, geht ihre Aktivität erst langsam wieder los.“ Momentan sind sie sehr aktiv in der Hilfe für die Ukrainer, haben schnell reagiert, denn die Mitglieder der deutschen und der ukrainischen Volksgruppe in der Region kennen sich in vielen Orten sehr gut.
Dabei sind das Coronavirus und der Krieg in der Ukraine nicht die einzigen Faktoren, die Einfluss auf die Radiosendung nahmen. Die Verschiebung der Sendezeit änderte die Hörerstruktur, und die Digitalisierung das Radio als solches. Die Sendungen sind übers Internet zu empfangen, und es gibt eine Seite der Medien der Deutschen Minderheit in der Republik Polen mit Hinweisen zur „Allensteiner Welle“. Um junge Menschen für das Medium Radio und eine Mitarbeit zu begeistern, gab es zuletzt in Zusammenarbeit mit der aktuellen Kulturmanagerin des Instituts für Auslandsbeziehungen IfA in der Region, Julia Herzog, ein Seminar für Sprechen im Radio.
„Das Radio ist gerade in diesen schwierigen Zeiten wichtig für unseren Zusammenhalt. Wichtig sind daher auch Rückmeldungen der Hörer zu unserer Sendung“, so der Vorsitzende des VdGEM Henryk Hoch, „für das Team zur Gestaltung der Sendung und für unsere Geldgeber, allen voran das IfA.“
Hören kann man die „Allensteiner Welle“ sonntags um 20.05 Uhr bei Radio Olsztyn oder auf www.ro.com.pl.
Von Uwe Hahnkamp,
Quelle: PAZ Nr.14-8. April 2022